Weitere laufende Projekte
Digitale Lerngruppenplattform

Das Zentrum für Lehren und Lernen (ZLL), der Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik – Berufliches Lehren und Lernen und die Universitäts-IT Mannheim (UNIT) entwickeln eine Plattform, die Studierenden das Bilden von fach- und semesterübergreifenden Lerngruppen mit zueinander passenden Kommiliton:innen erleichtern soll. Die Gruppen sollen dabei mittels eines Algorithmus automatisiert gebildet werden. Die dem Matching zugrundeliegenden Kriterien wurden zusammen mit Studierenden entwickelt.
Die Plattform soll in die universitäre IT-Infrastruktur eingebunden und zudem mit Microsoft Teams verbunden werden. So soll den Nutzer:innen digitale, kollaborative Zusammenarbeit ermöglicht werden. Zudem soll die Plattform den Studierenden die Möglichkeit bieten, Nachhilfe anzubieten bzw. anzunehmen. Auch sollen „Bibbuddys“ – Personen, mit denen man sich zum Lernen verabredet, jedoch nicht auf die selbe Klausur hin lern – gesucht werden können.
EXPLAIN
EXPLaining Ability INtervention

Das Projekt „EXPLAIN“ ist ein Kooperationsvorhaben der Universität Mannheim (Prof. Dr. Viola Deutscher, Prof. Dr. Jürgen Seifried) und der Universität Konstanz (JProf. Dr. Stefanie Findeisen) mit dem Ziel der Förderung und Erforschung der Erklärungskompetenz von angehenden Lehrkräften in der Wirtschaftsdidaktik.
Erklärungen sind für das Verständnis der Lerninhalte von großer Bedeutung und kommen im Unterricht mit hoher Frequenz und Dauer vor. In dem Projekt verbessern angehende Lehrkräfte ihre Fähigkeit, ökonomische Konzepte verständlich und adressatengerecht zu erklären. Die Erklärungsfähigkeit wird im Längsschnitt mit Hilfe einer interaktiven Videosimulation bewertet, in der angehende Lehrkräfte den Lernenden Fachkonzepte erklären. Zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten erhalten die Studierenden während des Semesters ein Interventionstraining.
Weiterführende Informationen finden Sie hier.
Lernen am Arbeitsplatzplatz im dualen Studium
Analyse von Praxisphasen in den Bachelorstudiengängen der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)
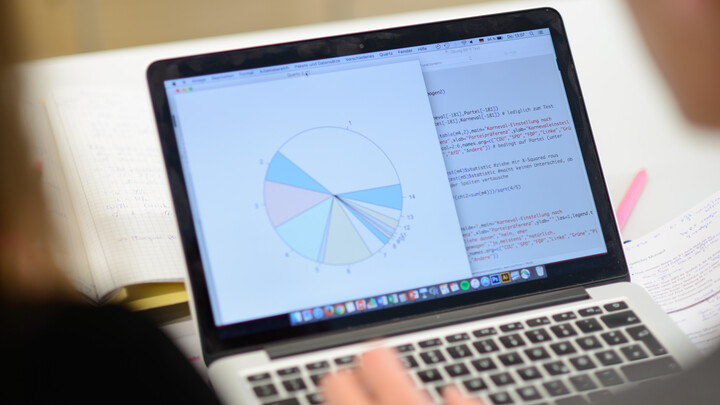
Das Projekt „Lernen am Arbeitsplatz im dualen Studium“ ist ein Kooperationsvorhaben der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) und der Universität Mannheim (Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik, Berufliches Lehren und Lernen).
Im Rahmen des Projekts werden Lernpotenziale und Wirkungen von Praxis- und Reflexionsphasen in den beiden dualen Bachelorstudiengängen Arbeitsmarktmanagement und Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung der HdBA untersucht. Eine derartige Untersuchung ist besonders in dualen Studiengängen von Relevanz, da diese einen besonders hohen Anteil an Praxisphasen aufweisen.
Um mehr über die Wirkungen der Praxis- und Reflexionsphasen im Verlauf des Studiums zu erfahren, ist das Projekt als eine Längsschnittstudie über die Praxistrimester hinweg angelegt (die Gesamtlaufzeit des Projekts beträgt vier Jahre). Zu Beginn der Untersuchungen werden die Studierenden bezüglich ihrer Ziele und Erwartungen für die Praxistrimester, ihrer Studieninteressen und ihrer beruflichen Selbstwirksamkeitseinschätzung befragt. Die Analyse der Lernprozesse während der Praxistrimester erfolgt mittels elektronischer Lerntagebücher, in denen die Studierenden durchgeführte Arbeitstätigkeiten dokumentieren und zusätzlich deren wahrgenommene Lernpotenziale beurteilen. Zum Ende der Praxistrimester werden die Kompetenzentwicklung der Studierenden sowie Potenziale des Lernortes Arbeitsplatz (im dualen Studium) erfasst.
Workplace Learning Support (WLS)

Im Projekt „Workplace Learning Support (WLS)“ wird der Umgang von Mitarbeitenden mit Standardsoftware im Büroalltag analysiert. Ziel ist es zu erfassen, wie Mitarbeitende lernen und wie diese Prozesse gefördert werden können.
Das Projekt ist eine Kooperation zwischen Führungskräften der SAP SE und tts GmbH sowie der Universität Mannheim.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Herausforderung Heterogenität
Theorie-Praxis-Kooperation zur evidenzbasierten und praxisorientierten Professionalisierung von angehenden Lehrkräften

Im Rahmen der jüngsten Reform der Lehrerbildung in Baden-Württemberg wurde ein Grundmodul zu Fragen der Inklusion und den Umgang mit Heterogenität für alle Lehramtsstudiengänge eingeführt. Dafür fördert das Land Baden-Württemberg in seiner Förderlinie „Leuchttürme der Lehrerbildung“ Projekte, die gezielt inhaltliche Schwerpunkte der Lehrerbildungsreform aufgreifen.
Das Mannheimer Projekt „Herausforderung Heterogenität – Theorie-Praxis-Kooperation zur evidenzbasierten und praxisorientierten Professionalisierung von (angehenden) Lehrkräften an beruflichen Schulen“ hat zum Ziel, angehende Lehrerinnen und Lehrer auf den Umgang mit zunehmender Heterogenität im Klassenzimmer vorzubereiten. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler ist eine entscheidende Komponente im professionellen Handeln von Lehrkräften. Dafür sollen Konzepte entwickelt werden, um den Herausforderungen der Heterogenität praxisnah, problemorientiert und forschungsbasiert zu begegnen.
Um sich der Thematik zu nähern, hospitieren Masterstudierende der Wirtschaftspädagogik im Rahmen eines Service Learning Lehrangebots an beruflichen Schulen in Mannheim (Friedrich-List-Schule, Max-Hachenburg-Schule, Eberhard-Gothein-Schule, Carl-Benz-Schule, Werner-von-Siemens-Schule, Carlo-Schmid-Schule). Ziel ist es, den Umgang mit Heterogenität zu beobachten, zu dokumentieren und zu analysieren. Die Erkenntnisse werden von folgenden Seminargruppen systematisch aufgearbeitet und für die Entwicklung und Überprüfung von schulischen Interventionen genutzt. Nach erfolgreicher Implementation stehen diese Maßnahmen auch für die Weiterbildung von (angehenden) Lehrpersonen zur Verfügung. Das Vorhaben verknüpft so Lernen in der Praxis und für die Praxis, Unterrichtsentwicklung und forschendes Lernen in der Lehrerbildung und adressiert somit zentrale Aspekte der professionellen Entwicklung von (angehenden) Lehrpersonen.
Kognitive Aktivierung im Wirtschaft und Gesellschaft-Unterricht in der Schweiz
in Kooperation mit Prof. Dr. Doreen Holtsch, Leiterin des Instituts für Professionsforschung und Kompetenzentwicklung an der Pädagogische Hochschule St.Gallen

Im Projekt geht es um die Analyse der Initiierung kognitiver und metakognitiver Aktivitäten von Lehrkräften im Wirtschaft und Gesellschaft-Unterricht in der Schweiz. Die Analyse erfolgt auf Basis von Videodaten, die im Rahmen des LINCA Leading House-Projekts am Lehrstuhl von Prof. Franz Eberle, Universität Zürich, im Herbst 2014 bei neun Klassen in jeweils zwei bis drei Lektionen des Ausbildungsberufs Kaufmann/
Ökonomische Experimente im Wirtschaftslehreunterricht

Das Projekt soll Erkenntnisse dazu liefern, wie das Verständnis grundlegender ökonomischer Konzepte mit Hilfe von ökonomischen Experimenten gefördert werden kann. Es geht um die Frage, inwiefern ökonomische Experimente geeignet sind, ökonomisches Denken zu fördern. Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums und des kaufmännischen Berufskollegs nehmen mehrfach an ökonomischen Experimenten zu öffentlichen Gütern (Fischerei-Spiel) teil. Das Experiment wurde eingesetzt, um im Kontext einer spieltheoretischen Dilemma-Situation die Eigenschaften von (unreinen) öffentlichen Gütern zu verdeutlichen. Ziel ist es, einen Einblick in den Lern- und Verstehensprozess der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu gewinnen.
